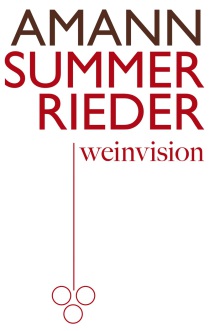Wein-Glossar
|
absetzen |
Der Jungwein wird vom Geläger getrennt. Das Abziehen des geklärten Weines aus einem Tank bzw. Fass vom Geläger. Der Wein wird dadurch von den Trubstoffen (grobe Hefe) befreit. |
|
|
Anreicherung |
Durch die Zugabe von Rübenzucker (Saccharose) zum Most, wird der Alkoholgehalt des zukünftigen Weines erhöht. Dieser Vorgang wird auch als Anreichern, Aufzuckern bzw. Chaptalisieren bezeichnet. Für österreichischen Qualitätswein ist als erlaubte Obergrenze 3,4 kg Saccharose für 100 l Most bzw. eine Alkoholerhöhung um maximal 2% vol festgelegt. |
|
|
alkoholische Gärung |
Durch die Hefe (Saccharomyces cerevisiae) wird bei der alkoholischen Gärung der vorhandene Zucker im Traubenmost zu Alkohol und CO2-Gas umgesetzt; dabei entsteht Wärme, die ebenso wie das Kohlensäuregas abgeführt werden muss (Traubenzucker + Hefe = Alkohol + Kohlendioxid + Wärme). |
|
|
Ausbau |
Ausbau- und Lagerungsphase des Weines nach vollendeter Gärung. |
|
|
Ausbruch |
Österreichischer Prädikatswein aus edelfaulen und eingeschrumpften Beeren; Spezialität aus Rust; lt. österreichischem Weingesetz beträgt das Mindestmostgewicht dafür 27° KMW. |
|
|
Auslese |
Österreichischer Prädikatswein aus vollreifen Trauben; lt. österreichischem Weingesetz beträgt das Mindestmostgewicht dafür 21° KMW. |
|
|
Ausstich |
Österreichische Bezeichnung für Selektion; die besten Fässer werden mittels Stichheber ermittelt. Besondere Berühmtheit erlangte der St. Laurent Ausstich vom Stift Klosterneuburg. |
|
|
Beerenauslese |
Für diese Qualitätsstufe müssen die Trauben lt. österreichischem Weingesetz überreif und vollständig von Edelfäule befallen sein und ein Mostgewicht von mindestens 25 ° KMW aufweisen. Maximalertrag 9000 Kilogramm / Hektar, Mindestalkoholgehalt 5 Prozent. |
|
|
Bergland |
Österreichische Weinbauregion, in der die Weinbaufläche der Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg zusammengefasst ist. |
|
|
Bitterfäule |
Krankheit, die durch den Pilz Greenia uvicola bei feucht-warmem Wetter verursacht wird, die überreifes Gewebe angreift und einen bitteren Geschmack im Wein verursacht. Wird durch Fungizide unter Kontrolle gebracht. |
|
|
Blauer Burgunder |
Die Burgundersorten leiten sich von einer Kreuzung Schwarzriesling x Traminer ab. Der Blaue Burgunder kann auf idealem Standort, bei hoher Reife und gekonnter Vinifikation hochwertige, lagerfähige Weine hervorbringen, auch wenn die sensible Sorte im Weingarten und im Keller eine Herausforderung darstellt. |
|
|
Blauer Portugieser |
Der Blaue Portugieser ist mit der Sorte „Português Azul“ ident und wurde von Freiherrn von Fries um 1770 aus Porto nach Vöslau gebracht. Noch heute ist der Portugieser in der Thermenregion die häufigste Rotweinsorte, weit vor Zweigelt und den Burgundern. |
|
|
Blauer Wildbacher |
Der blaue Wildbacher ist ein Heunisch-Sämling, nahe verwandt auch mit Blaufränkisch. Im Gegensatz zur sehr kleinen Anbaufläche – seine Heimat ist die Weststeiermark – steht der Bekanntheitsgrad des vorwiegend daraus gekelterten Schilchers. |
|
|
Blauer Zweigelt |
In den 1920er Jahren von seinem Namensgeber Professor Fritz Zweigelt aus Blaufränkisch und St. Laurent gekreuzt, schrieb die Sorte erst nach dem Krieg eine Erfolgsstory. |
|
|
Blaufränkisch |
Der Blaufränkisch ist ein richtiger „Mitteleuropäer“. Diese uralte Sorte stammt von einer Heunisch-Kreuzung, der zweite Elternteil ist unklar. Verbreitet ist sie vor allem in den Ländern der ehemaligen Habsburger-Monarchie. |
|
|
Burgenland |
Unter dem Einfluss des kontinental-heißen pannonischen Klimas wachsen im östlichsten Bundesland auch die körperreichsten Rotweine Österreichs. Dabei gibt es bei den natürlichen Voraussetzungen nicht zu unterschätzende Unterschiede. |
|
|
Buschenschank |
Andere Bezeichnung für "Heuriger" (in Deutschland Straußenwirtschaft); ein Lokal in dem Eigenbauweine und mehr oder weniger einfachere Speisen verabreicht werden. |
|
|
Carnuntum |
Archäologen fördern seit vielen Jahren Zeugnisse der römischen Kultur aus dem geschichtsträchtigen Boden von Carnuntum. Doch ebenso erstaunlich sind die „Bodenschätze“ von den rund 910 Hektar Rebfläche, allen voran gebietstypische Rotweine. |
|
|
Cryoextraktion |
Gesundes Traubenmaterial wird in Kühlzellen tiefgefroren; das Ergebnis ist ein „künstlicher“ Eiswein. |
|
|
degorgieren |
Entfernen des Hefesatzes aus der Flasche beim Schaumwein bei der klassischen Methode. |
|
|
Dosage |
Nach dem Degorgieren bzw. vor der Flaschenfüllung wird dem Schaumwein der endgültige Restzuckergehalt verliehen. Bei der Flaschengärung unterscheiden wir zwischen Fülldosage („liqueur de tirage“) und Versanddosage (liqueur d`expédition). Erstere ist ein Wein-Zucker-Hefe-Gemisch, um die zweite Gärung zu starten, die Versanddosage legt den endgültigen Geschmackstypus fest und fällt oft unter das Betriebsgeheimnis. |
|
|
Edelfäule |
Botrytis cinerea, ein Schimmelpilz der für die Edelfäule verantwortlich ist, bewirkt Wasserverdunstung und Konzentration der Inhaltsstoffe der Beeren sowie Geruchs- und Geschmacksveränderung; erfolgt regelmäßig nur in klimatisch bevorzugten Gebieten (z.B. Seewinkel, Rust). |
|
|
Einmaischen |
Meist werden die Beeren nach dem Rebeln gequetscht, um den Saftaustritt zu erleichtern. |
|
|
Eiswein |
Eine Spezialität aus Österreich und Deutschland; Eiswein wird aus Trauben erzeugt, die bei der Lese und beim Presse auf natürliche Weise gefroren sein müssen (je nach Zuckergradation ca. minus 6 bis minus 10°C); das Mindestmostgewicht beträgt 25° KMW. In Österreich vor allem im Weinviertel, am Wagram und im Burgenland angestrebt. |
|
|
entrappen |
Das Abbeeren (so der deutsche Ausdruck) bzw. Trennen der Beeren von den Stielen vor dem Pressen. |
|
|
falscher Mehltau |
Pilzkrankheit des Rebstocks - auch Peronospora genannt. |
|
|
Federspiel |
Bezeichnung für nicht aufgebesserte Weine zwischen 11,5 und 12,5% Alk. Die Bezeichnung erinnert an das Federspiel der Kuenringer Falkner; siehe auch Steinfeder und Smaragd. |
|
|
Flotation |
Methode zur Weinklärung, bei der Edelgas im Boden des Behälters eingelassen wird, wodurch der Trub an die Oberfläche geschwemmt wird, wo er leicht entfernt werden kann. |
|
|
Frühroter Veltliner |
Roter Veltliner und Sylvaner sind die Eltern der sehr alten Rebsorte. Die Bedeutung des Frühroten Veltliners nimmt ab, meist wird sie als Tafeltraube, Primeurwein oder auch Schankwein – vor allem in der Thermenregion, Weinviertel und am Wagram – vermarktet. |
|
|
Grüner Sylvaner |
Die weiße Sorte zählt zu den ältesten kultivierten Reben in Europa. Die Kreuzung zwischen Traminer und Österreichisch Weiß wird auch „Österreicher“ genannt. |
|
|
Grüner Veltliner |
Die mit Abstand wichtigste Weißweinsorte in Österreich ist der Grüne Veltliner, der wahrscheinlich von einer Traminer Kreuzung abstammt. Größte Verbreitung hat die Nationalsorte im niederösterreichischen Weinviertel, wo sie als herkunftstypischer Weinviertel DAC Wein eine besondere Rolle spielt. |
|
|
Gärbehälter |
Stahltank, Bottich, Holzfass, früher auch Betonzisterne und für Kleinstmengen sogar Glasballon, für das Vergären von Wein. |
|
|
Geläger |
Sedement abgestorbener Hefen und weiterer Trubstoffe im Fass oder Tank. Sauberes Geläger kann auch gebrannt werden; das Ergebnis ist als Geläger-, Glöger- oder Hefebrand bekannt. |
|
|
Grauburgunder |
Der Grauburgunder (auch Pino Gris) ist das „familiäre“ Bindeglied zwischen Pinot Noir und Pinot Blanc in der großen Burgundergruppe. |
|
|
Graufäule |
Befällt der Schimmelpilz Botrytis cinerea unreife Beeren, so ist die Folge Grau- oder Grünfäule. |
|
|
G'spritzter |
Die Mischung aus Wein mit Soda- bzw. Mineralwasser wird in Österreich als Gespritzter oder G´spritzter bezeichnet. Der G´spritzte ist ein Durstlöscher, vor allem in der warmen Jahreszeit, wird aber auch als Aperitif oder unkomplizierter Speisenbegleiter (wegen seines geringen Alkoholgehalts) gerne eingesetzt. Je nach Mischungsverhältnis (normalerweise 1:1) wird er auch als Sommerg´spritzter (mit mehr Wasser) gerne getrunken. |
|
|
Hefe |
Pilze, die sich durch Sprossung fortpflanzen; sie wandeln Zucker in Alkohol um. „Natürliche“ Hefen sind im Weingarten und auf den Trauben reichlich vorhanden (Spontanhefen). Wichtige Hefearten für die Vinifikation gehören der Gattung |
|
|
Heuriger |
Einerseits für Wein aus der letzten Ernte; früher war der Stichtag der 11. November. Andererseits das Lokal, in dem Eigenbauweine sowie mehr oder weniger einfache Speisen verabreicht werden. Siehe auch Buschenschank; in Deutschland als Straußenwirtschaft bezeichnet. |
|
|
Hochkultur |
Drahtrahmenerziehung die in Österreich von Lenz Moser um 1930 entwickelt wurde, um die Weingartenarbeit mit maschineller Unterstützung zu ermöglichen. |
|
|
Holzausbau |
Ausbau und Lagerung von Weinen im großen oder kleinen Holzfass. |
|
|
Integrierter Pflanzenschutz |
Umweltfreundlicher Ansatz zur Kontrolle von Krankheiten und Schädlingen im Weingarten, der in Österreich sehr verbreitet ist. |
|
|
Interspezifische Kreuzung |
Nachkommen von zwei unterschiedlichen Spezies |
|
|
Kabinett(wein) |
Hochwertiger Qualitätswein mit einem natürlichen Mindestmostgewicht von 17° KMW, einen max. Gesamtalkoholgehalt von 13% vol. Der Restzuckergehalt darf höchstens 9 g/l betragen; das Lesegut darf weder aufgebessert noch der Wein gesüßt sein. Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen wie beim Qualitätswein. |
|
|
Kamptal |
Namensgeber ist der Fluss Kamp, Hauptort ist Österreichs größte Weinstadt Langenlois. Mit zahlreichen international bekannten Spitzenbetrieben ist das Kamptal eines der erfolgreichsten Weinbaugebiete des Landes. |
|
|
Kellergasse |
In vielen österreichischen Weinbaugebieten traditionelle Kelleranlagen außerhalb des Ortsgebietes. Diese „Dörfer ohne Rauchfänge“ sind oft in mehreren Etagen übereinander angebracht (Kellerberg). Sie bestehen aus Presshäusern, dem sogenannten Kellerhals und dem unterirdischen Kellergewölben; die manchmal labyrinthartigen Gänge sind oft miteinander verbunden. |
|
|
Kleinbeerigkeit |
Anordnung der Beeren einer Traube, die fingernagelgroß sind und nicht dicht an dicht stehen. |
|
|
Klosterneuburger Mostwaage (KMW) |
1° KMW entspricht einem Dekagramm Zucker in einem Kilogramm Most. Erfinder war der Gründer der Klosterneuburger Weinbauschule August Wilhelm Freiherr von Babo. Heute wird das Mostgewicht meist mit dem Refraktometer gemessen. |
|
|
Kohlensäure-assimilation |
Der essenzielle erste Schritt in der Weinwerdung: Mit Hilfe der Sonnenenergie bildet sich aus Wasser und Kohlendioxid Zucker in den Beeren. |
|
|
Kremstal |
Die Rebfläche des Kremstals verteilt sich auf drei unterschiedliche Zonen: das eigentliche Kremstal und die historische Stadt Krems, deren westlicher Teil namens „Stein“ direkt an die Wachau anschließt, die östlich anschließenden mächtigen Lössmassive und die kleinen Weinorte südlich der Donau rund um das monumentale Stift Göttweig. |
|
|
Landwein |
Landweine dürfen aus den 35 zugelassenen Qualitätsrebsorten erzeugt werden. Die Trauben müssen aus einer der drei Weinbauregionen Weinland, Steirerland oder Bergland stammen. |
|
|
Malolaktische Gärung |
Umwandlung der aggressiven Apfelsäure in die mildere Milchsäure und Kohlendioxid durch erwünschte Bakterien. |
|
|
Mittelburgenland |
Eine Rotweinsorte spielt auf den Rebflächen des Weinbaugebietes Mittelburgenland die Hauptrolle: der Blaufränkisch, der in Form von DAC Weinen seine Herkunft idealtypisch repräsentiert. |
|
|
Muskat Ottonel |
Einer der jüngeren Vertreter der alten Muskatfamilie ist der Muskat-Ottonel. Der in Frankreich gezogene Sämling entspricht einer Kreuzung aus Gutedel (Chasselas) und einer nicht genau definierbaren Muskatvariante. |
|
|
Muskat-Sylvaner |
Synonym für Sauvignon Blanc, der vermutlich aus einer Kreuzung aus Traminer x Chenin Blanc stammt. Er gilt als Shootingstar speziell unter den steirischen Weinen, dabei wurde er dort bereits im 19. Jahrhundert unter der Bezeichnung „Muskat-Sylvaner“ von Erzherzog Johann eingeführt. |
|
|
Neusiedler See |
Das Weinbaugebiet Neusiedlersee im Osten des Neusiedler Sees reicht von den Hügeln um die große Weinstadt Gols über den flachen Heideboden bis hinunter in den melancholischen Seewinkel. Hier reift an den Ufern des flachen Steppensees eine große Sortenvielfalt heran. |
|
|
Neusiedlersee-Hügelland |
Kaum ein anderes Weinbaugebiet erlaubt eine solche Vielfalt an Weintypen wie das Gebiet am Westufer des Neusiedlersees. Mit dem Ruster Ausbruch ist auch einer der berühmtesten Süßweine der Welt ein Fixpunkt der regionalen Weinidentität. |
|
|
Niederösterreich |
Niederösterreich ist Österreichs größtes Qualitätsweinbaugebiet. Unter seinem Namen vereint sich ein reichhaltiges Potenzial von Weinherkünften und Weinstilen heimischer Weinraritä¬ten, aber auch internationaler Rebsorten. |
|
|
Pektolytische Enzyme |
Enzyme werden manchmal Most mit hohem Pektin-Gehalt zugesetzt, damit sich Trub und Schwebeteilchen rascher absetzen. |
|
|
Pfropfen |
Zur Vermehrung oder zum Erhalt des Rebstockes wird dabei ein Edelreis mit einer Unterlage zusammengefügt. Wegen der Reblaus wird ein Edelreis auf einem widerstandsfähigen amerikanischen Wurzelstock verbunden. |
|
|
Pressmost |
Der bei den ersten Pressvorgängen gewonnene Most heißt "Pressmost". |
|
|
Qualitätswein |
Die Bezeichnung „Qualitätswein“ dürfen nur Weine tragen, die aus einer oder mehreren der 35 zugelassenen Qualitätsrebsorten erzeugt wurden und aus einem gesetzlich definierten Weinbaugebiet mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) stammen. |
|
|
Rebel- und Einmaischmaschine |
Ein modernes Gerät, das zum Entrappen (Rebeln) und Anquetschen der Trauben verwendet wird, wobei jeder Vorgang einzeln zugeschaltet werden kann. |
|
|
Reberziehung |
Rebschnitt im Winter, Aufbinden und Laubarbeit während der Vegetationsperiode, um den Rebstöcken am Drahtrahmen in eine bestimmte Form zu bringen. |
|
|
Reblaus |
Phylloxera vastatrix. Ein Rebschädling, der sich von den Wurzeln aber auch von den Blättern der Weinrebe ernährt. Durch das Anbohren der Wurzeln von europäischen Edelreben kommt es zum Absterben des Weinstocks. In der zweiten Hälfte des19. Jahrhunderts wurde dadurch der gesamte europäische Weinbau stark geschädigt. Nur durch das Aufpfropfen der europäischen Edelreiser auf amerikanische, reblausresistente Unterlagsreben (Wurzeln) konnte eine totale Vernichtung des Weinbaus verhindert werden. |
|
|
Rebschnitt |
Bei diesem Winterschnitt erfolgt die Anpassung an die gewünschte Erziehungsform und hat damit Einfluss auf die spätere Qualität des Weines (Menge-Güte-Gesetz). Je nach Schnittform sprechen wird vom Zapfen (2 – 3 Augen), Strecker (4 – 5 Augen), Rute (6 – 8 Augen) oder Bogen (über 8 Augen). |
|
|
Rebsorte |
Von den elf ampelographischen Gruppen ist die Unterart Vitis vinifera für uns von besonderer Bedeutung. Je nach Reifeverhalten unterscheiden wir zwischen früh reifenden und spät reifenden Rebsorten. Auch eine Einteilung in autochthone (einheimische) und internationale Rebsorten wird vorgenommen. |
|
|
rösten (Toasting) |
Röstige Würze, die vom Barriqueausbau stammt (toasten = Fass ausbrennen), dadurch werden Geschmackstoffe an den Wein abgegeben; die Bandbreite des Toastings reicht von light über medium bis heavy. |
|
|
Rotgipfler |
Der Rotgipfler ist eine Kreuzung aus Traminer und Rotem Veltliner. Mit dem „Weißgipfler“ (= Grüner Veltliner) ist er verwandt. |
|
|
RTK (Rektifiziertes Traubenmostkonzentr.) |
RTK ist eine konzentrierte Invertzuckerlösung, die aus minderwertigem Traubensaft aus Europas Weinsee hergestellt wird. |
|
|
Ruländer |
In Österreich verwendetes Synonym für Pinot Gris. |
|
|
Rütteln |
Nach der zweiten Gärung sammelt sich die abgestorbene Hefe am Flaschenboden, diese wird maschinell oder händisch in den Flaschenhals gerüttelt um schließlich entfernt zu werden. |
|
|
Säureregulierung |
Allgemeine Praxis in wärmeren Klimazonen, um die Säure im Most oder Wein zu erhöhen (Europäische Weinmacher aus nördlicheren Gebieten scherzen oft, dass sie RTK aus dem Süden nur akzeptieren, wenn die Weinmacher im Süden ihre überschüssige Säure nehmen. |
|
|
Scheitermost |
Saft von minderwertigerer Qualität der aus dem Maischekuchen herausgepresst wird nachdem Seihmost und Pressmost abgelaufen sind; wird nicht in Qualitätsweinen verwendet. |
|
|
Schilcher |
Der blaue Wildbacher ist ein Heunisch-Sämling, nahe verwandt auch mit Blaufränkisch. Im Gegensatz zur sehr kleinen Anbaufläche – seine Heimat ist die Weststeiermark – steht der Bekanntheitsgrad des vorwiegend daraus gekelterten Schilchers. |
|
|
Schmelz, Reif |
Geschmackliche Eigenschaft von Weinen, die einen hohen Alkohol- und Glyzeringehalt aufweisen und dabei Säure bzw. Tannin harmonisch integriert haben. |
|
|
Seihmost |
Most, der ohne Pressen von selbst abfließt (Vorlaufmost). |
|
|
Smaragd |
Bezeichnung für nicht aufgebesserte trockene Weine aus physiologisch reifen Trauben ab einem Alkoholgehalt von 12,5% Alk. Die Bezeichnung erinnert an die Smaragdeidechse, die sich in den Wachauer Weinbergterrassen besonders wohl fühlt; siehe auch Steinfeder und Federspiel. |
|
|
Spätlese |
Weinkategorie im österreichischen Weingesetz; die Trauben müssen besonderen Anforderungen entsprechen und sind nach dem Mostgewicht aufgebaut. |
|
|
Spätrot |
Eine Rarität der Thermenregion ist die autochthone Sorte Zierfandler. Das Synonym „Spätrot“ verweist auf die spät reifenden Trauben, die sich an der Sonnenseite rötlich färben. |
|
|
St. Laurent |
Die hochwertige Sorte St. Laurent gehört zur großen Burgunderfamilie – das Synonym Pinot St. Laurent weist auf einen Burgunder-Sämling hin. |
|
|
Steckengebliebene Gärung |
Ist die Gärtemperatur zu hoch oder sind die Hefen zu schwach, kann es passieren, dass der Gärprozess zum Erliegen kommt und der Wein mit unerwünschter Restsüße „stecken bleibt“. |
|
|
Stehenlassen |
Technik, die verwendet wird um geschmacksintensivere Weißweine zu erhalten. Der Most ist mit den Beerenhäuten bis zu acht Stunden und länger bei niedriger Temperatur in Kontakt. Risikoreich, wenn die Trauben nicht einwandfrei gesund sind. |
|
|
Steiermark |
Die Steiermark mit ihren extrem steilen Weingärten ist eine der schönsten Weinlandschaften Europas. Hier wachsen einige der besten Sauvignon Blancs der Welt. |
|
|
Steinfeder |
Der Name kommt vom typischen Steinfedergras, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Reben auf den Terrassen der Wachauer Weinberge wächst und in seiner Struktur ebenso leicht ist, wie der namensgleiche Wein. Siehe auch Federspiel und Smaragd. |
|
|
Strohwein |
Wein aus vollreifen und zuckerreichen Beeren, die vor dem Pressen mindestens drei Monate auf Stroh bzw. Schilf gelagert werden; durch diesen Konzentrationsprozess (Eintrocknen der Beeren) wird das nötige Mindestmostgewicht von 25° KMW erreicht. |
|
|
Südburgenland |
Die ursprünglichste Weinlandschaft des Burgenlandes erstreckt sich von Rechnitz im Norden bis nahe Güssing in den Süden. Die authentischen Rotweine, speziell vom Blaufränkisch, sind von einer besonders mineralischen Würze geprägt. |
|
|
Thermenregion |
Die Weingärten der Thermenregion liegen am Rande des Wienerwaldes. Im nördlichen Teil dominieren fruchtige, körperreiche Weißweine der Sorten Zierfandler und Rotgipfler. |
|
|
Traisental |
Österreichs jüngstes Weinbaugebiet ist auch eines seiner kleinsten. Mineralisch-würzige Traisental DAC Veltliner und Rieslinge sorgten bereits international für Aufsehen. |
|
|
Traube |
Fruchtstand der Rebe. |
|
|
Traubenstiel |
Stielgerüst, auf dem die Beeren sitzen |
|
|
Trester |
Die Masse der abgepressten Schalen und Kerne (ev. auch Stiele) von Weintrauben, die zur Düngung im Weingarten oder zur Weiterverarbeitung als Tresterbrand (in Italien: Grappa; in Frankreich: Marc) verwendet werden können. |
|
|
Tresterhut |
Die festen Bestandteile (Schalen und Kerne ev. auch Stiele) von Rotweintrauben, die bei der Maischegärung vom Kohlensäuregas aufgetrieben werden und auf dem Most schwimmen. Um qualitativ hochwertigen Rotwein mit genügend Farbe und Tannin zu erhalten, ist es notwendig, den Tresterhut ständig feucht zu halten. |
|
|
Triebe |
Jungtrieb der Rebpflanze. |
|
|
Trockenbeerenauslese |
Beerenauslese aus größtenteils edelfaulen, weitgehend eingeschrumpften Beeren mit einem Mindestmostgewicht von 30° KMW. |
|
|
Umkehrosmose |
Dem Most wird teilweise traubeneigenes Wasser entzogen; dabei wird eine Filtermembran verwendet, die eine so geringe Porenweite hat, dass nur Wassermoleküle bei hohem Druck hindurch können. Diese Konzentriermethode ist in der EU seit einigen Jahren erlaubt und wird als Alternative zum Aufbessern bei der Rotweinbereitung auch in Österreich teilweise eingesetzt. |
|
|
Umpumpen |
Prozess, bei dem gärender Rotwein über den Tresterhut gepumpt wird, um die Beerenhäute besser auszulaugen. |
|
|
Umziehen |
Moste oder Weine werden durch Gravitation oder mit Hilfe von Pumpen von einem Behältnis in ein anderes umgefüllt und somit von den Trubstoffen getrennt oder dadurch bewusst dem Luftsauerstoff ausgesetzt (bei der Rotweinbereitung). |
|
|
Unterlagsreben |
Als Unterlagen werden Amerikanerreben oder Hybriden verwendet, die gegen die Reblaus resistent sind. In Österreich häufig verwendete Unterlagsreben sind Kober 5 BB, SO 4, 5 C. |
|
|
Vakuumverdampfung |
Dabei wird dem Most teilweise traubeneigenes Wasser entzogen. Im Vakuum verdampft bereits bei Temperaturen von 25 bis 30° C Wasser, ohne das Aroma des späteren Weines zu schädigen. Diese Konzentriermethode ist in der EU seit einigen Jahren erlaubt und wird als Alternative zum Aufbessern bei der Rotweinbereitung auch in Österreich teilweise eingesetzt. Vakuumverdampfung eignet sich auch zur Herstellung von alkoholfreien Weinen. |
|
|
Verbesserung (aufbessern) |
Durch die Zugabe von Rübenzucker (Saccharose) zum Most, wird der Alkoholgehalt des zukünftigen Weines erhöht. Dieser Vorgang wird auch als Anreichern, Aufzuckern bzw. Chaptalisieren bezeichnet. Für österreichischen Qualitätswein ist als erlaubte Obergrenze 3,4 kg Saccharose für 100 l Most bzw. eine Alkoholerhöhung um maximal 2% vol festgelegt. |
|
|
Veredelung |
Das Aufpfropfen von europäischen Edelreisern auf reblausresistente Unterlagen durch geübte Rebveredler in Rebschulen. |
|
|
Verrieselung |
Die Folgen davon sind Lockerbeerigkeit und geringerer Ertrag. Besonders verrieselungsanfällige Rebsorten sind u.a. Muskat Ottonel, Neuburger, St. Laurent. |
|
|
Verschneiden |
Assemblage - Französische Bezeichnung für Verschnitt |
|
|
Wachau |
Weltkulturerbe und Wohlfühllandschaft – das ist die Wachau, das enge Donautal zwischen Melk und Krems. Die Weinkategorien Steinfeder, Federspiel und Smaragd stehen für die Naturbelassenheit der Wachauer Weine. |
|
|
Weinbeere |
Frucht der Weintraube, bestehend aus Beerenschale, Fruchtfleisch und Kernen. |
|
|
Weinviertel |
Aus der Vielzahl der Rebsorten, die in diesem Gebiet gekeltert werden, ragt der Grüne Veltliner besonders heraus. Ein ausgeprägt pfeffrig-würziges Bukett prägt hier seinen herkunftstypischen Charakter. |
|
|
Weißer Burgunder |
Österreichisches Synonym für Pinot Blanc. Die international weit verbreitete Sorte – übrigens das jüngste Mitglied der verzweigten Burgunderfamilie – kennzeichnet ein elegantes, oft zurückhaltendes Bukett sowie eine reife Säurestruktur. |
|
|
Welschriesling |
Der Welschriesling stammt vermutlich aus Norditalien („Riesling italico“). Als nächster Verwandter gilt der Elbling. Die Sorte wird auch in Ungarn (Olász Rizling), Slowenien (Laski Riesling) und Kroatien (Graševina) gepflegt. |
|
|
Weststeiermark |
In der romantischen Weststeiermark entfallen über 70% der Fläche auf die Blaue Wildbacher-Traube, aus der ein einzigartiger Terroir-Wein gekeltert wird, der Schilcher - eine roséfarbige Rarität. |
|
|
Wien |
Die Weingärten der österreichischen Hauptstadt spielen sowohl kulturell, als auch wirtschaftlich eine bedeutende Rolle. Die Vielfalt an Rebsorten reicht vom Grünen Veltliner bis zu Rotweinen. |
|
|
Zierfandler |
siehe Spätrot |
|
|
Zweigelt |
In den 1920er Jahren von seinem Namensgeber Professor Fritz Zweigelt aus Blaufränkisch und St. Laurent gekreuzt, schrieb die Sorte erst nach dem Krieg eine Erfolgsstory. |
|